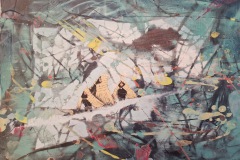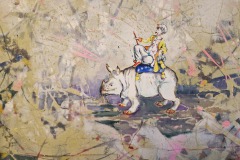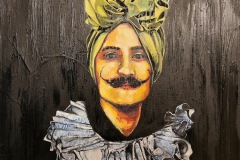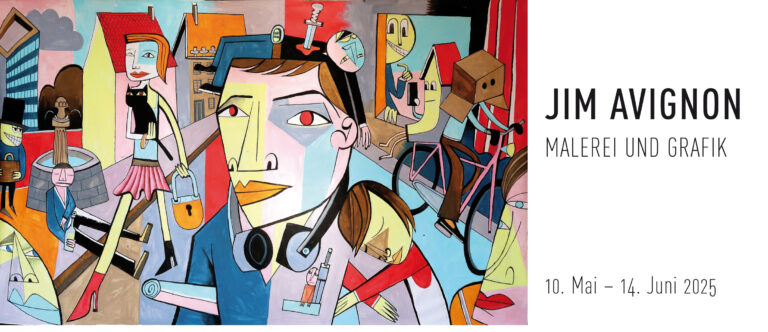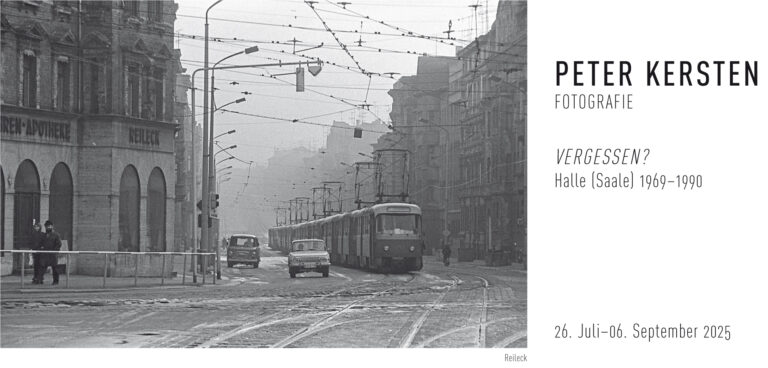„Wie die Erinnerung es will"
Eröffnungsrede von Rüdiger Giebler zu Andrea Damp
Sehr verehrte Damen und Herren,
liebe Andrea Damp
lieber Martin Möhwald, Thomas, lieber Professor Brade,
liebe halleschen Sportsfreunde,
Was mußte ich vor kurzem lesen: Astrophysiker vermuten, dass man unser Universum als eine Art Projektion aus einer zweidimensionalen Oberfläche heraus verstehen kann. Genaues weiß man nicht. Das ist aber auch nix Neues für Unsereins. Malerinnen und Maler wussten immer schon, daß irgend etwas faul ist. Malerinnen und Maler arbeiten und denken in dieser Zweidimensionalität. Und zur Not können wir uns auch dorthin flüchten und verschwinden.
Überhaupt, alles wird zweidimensional. Alle Kommunikation, alle Lyrik wird, und Theaterstücke und Prosa werden immer mehr zu Textflächen. Von Elfriede Jelinek bis zu dem Jugendlichen gegenüber in der S-Bahn, der sich über die Freisprechanlage seines Telefons mit seinesgleichen austauscht. Projektionen von Projekten.
Malerinnen sind Flächendenker. Wir machen das schon länger als die Dramatikerinnen. (Ich ordne mich da mal einfach mit ein) Malerei ist die Unterscheidung in wichtig und unwichtig im Hirn des Betrachters. Es gibt nix wirklich Wichtiges: Außer man träumt es.
Diese Bilder sind Überlagerungen von verschwommenen Projektionen. Überlagerungen von Erinnerungen, Träumen, Ängsten, Naturerfahrungen, Wahnideen und Fantasy-Filmen. Solche Überlagerungen können wir alle jederzeit und überall finden. Bei Rossmann gibt es ein Regal mit (unter anderen) Topflappen, Katzenfutternäpfen und Kosmetik-Rasierern. Das Regal hat einen Namen. Darüber steht ganz groß IDEENWELT.
Zurück zu den Birken, die aus dem Nebel auftauchen. Es sieht anheimelnd aus und gefährlich. Genau SO träume ich auch immer. Die Welt ist total verschleimt. Zum Rand hin wird alles unscharf. Kabelstränge, Schilf und leichte Holzkonstruktionen. Tropengewächse in fehlfarbenen Silhouetten. Überall Schlingpflanzen – über und unter Wasser. Nur hat das Wasser keine erkennbare Oberfläche, man kommt da nicht raus, alles ist eine dunstige Atmosphäre. Die Wege sind brüchige Holzstege auf denen es keinen rechten Halt gibt. Das hier sind verbildlichte Fallträume. Normalerweise geht das einher mit Kontrollverlust, Hilflosigkeit und Unsicherheit. Im Falltraum geht es um ausweglose Situationen, oder es wird vor etwas im Wachzustand verdrängtem gewarnt. Dinge, die ausweglos erscheinen oder bei denen das Gefühl aufkommt, die Kontrolle zu verlieren. Zum Beispiel Versagensängste, der Partner könne fremdgehen, der Job ist in Gefahr – oder man muß politische Kompromisse machen.
Diese Träume hier sind sanfter. Ich will nicht von Pudding oder Götterspeise sprechen. Aber immer findet sich eine tragende Schicht für die Akteure, und eine gewisse Süße kann man dem Ganzen auch nicht absprechen.
Und dann immer wieder diese Seifenblasen, die partout nicht platzen wollen. Wie die Löcher im Schweizer Käse, von außen gesehen, wenn der Käse durchsichtig wäre.
Blasen, die steif und unverrückbar in der Atmosphäre stehen, wie Lampions, die es auch gibt – oder Sumpflichter, Seelen ohne Körper. Auch leibhaftige Wesen, ausgestattet mit einer rätselhaften Biolumineszenz. Glühwürmchen in allen Größen. Durch die Nacht schweben die Seifenblasen unerfüllter Wünsche. Das ist eine sehr eigene Atmosphäre, ein gesättigter Raum.
Und nun auch noch Sechsecke. Auf Fotos werden die Blendenreflexe genannt. Die entstehen wenn starkes Licht durch den Verschluss des Objektives fällt und sich an den Linsen des Apparates spiegelt. Eine Überlastung des Apparates die sich in hellen Phantomeffekten entlädt.
Die Menschen auf den Bildern sind oft winzig. Däumlinge, die unbeirrt tun, was in psychedelischen Dämpfen zu tun ist: Gymnastik, Kreistänze, Yoga oder einfach nur in die Wunderwelt hineinstaunen. Das sind Rest-Märchen-Akteure in Baumwipfeln, die ihre Ruhezonen in Farbschlieren suchen.
Déjà-vu heisst eine Bilderserie. Projektion aus einer zweidimensionalen Oberfläche in die Realität und zurück. Eine gemalte Erinnerungstäuschung.
Das Personal scheint sich jedenfalls wohlzufühlen, wo immer sie auch sind und machen einen erstaunlich gelassenen Eindruck. Alle sind gut angezogen. Körperlich fit und wohl auch seelisch offensichtlich stabil. Mangelernährung ist nicht festzustellen.
Manche haben auch teure Requisiten in die Hand bekommen, wie ein Teleskop, mit dem man im dicken Nebel allerdings nicht weit gucken kann.
Die Bilder von Andrea Damp erklären sich erst, wenn man den miniaturisierten Details nachgeht. Die erkennt man nur wenn man nah an die Leinwand tritt.
Diese Bildelemente stecken im Nebel wie kleine Fehlstellen. Und diese kleinen Details erklären das ganze Bild. Oder auch nicht, wie bei dem Bild der jungen Frau mit dem Eisvogel auf dem Kopf. Betitelt mit „Tacende“, kommt aus dem Latein und bedeutet „Dinge, die besser ungesagt bleiben, nicht öffentlich gemacht werden oder die man beiseite lassen sollte“, also schweigen.
Und damit habe ich den Punkt erreicht, an dem ich gern unvermittelt abbrechen möchte.
ANDREA DAMP
Die Bilder von Andrea Damp sind wie fernsehgucken ohne Fernsehen. Das geht bestens, wenn man die richtigen Tafeln an der Wand hat. Man sucht und sucht im Bild und findet was im eignen Kopf. (Rüdiger Giebler)
Vita
1977 geboren in Bergen auf Rügen
1997-1998 Studium der Philosophie und Kunstgeschichte an der
Freien Universität Berlin
1998-2004 Studium der Freien Kunst an der UdK Berlin
bei Prof. Hans-Jürgen Diehl
2000-2001 Stipendium der Dorothea-Konwiarz Stiftung für Malerei
2004 Absolvent der Universität der Künste Berlin;
Stipendium an der Glasgow School of Art
2004-2005 Meisterstudium an der Universität der Künste (UdK)
bei Prof. Hans-Jürgen Diehl in Berlin
Abschluss Meisterschüler
2006-2007 NaföG-Stipendium des Berliner Senats
2008 Lucas-Cranach-Stipendium der Stadt Wittenberg
2008-2010 Karl-Hofer-Stipendium
2009 Franz-Hecker-Stipendium (2. Preis)
Stipendium der Käthe-Dorsch-und-Agnes-Straub-Stiftung
2010 Preis der Dorothea-Konwiarz-Stiftung für Malerei
2014 Preisträger 12. Kunstpreis Tempelhof/Schöneberg (3. Preis)
2014-2017 Lehrauftrag an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW), Hamburg
2019 Artist-in-Residence, Art Factory, Budapest,
Lebt und arbeitet in Berlin.
MARTIN MÖHWALD
Der Keramiker Martin Möhwald ist ein ganz Großer der zeitgenössischen Keramik.
Möhwald ist Mitglied einer künstlerisch hochbegabten Familie: Sein Vater Otto Möhwald war Maler, seine Mutter Gertraud Möhwald, wie er, Keramikerin, ein Neffe ist ein bekannter Schriftsteller. Um die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle lebt ein Kosmos kreativer und erfolgreicher Künstlerinnen und Künstler. Möhwald, einer von ihnen, hat sein Atelier in der Burgstraße,
einen Steinwurf von der Hochschule entfernt. Er ist dieser Stadt treu geblieben: vor und nach 1989, kehrte er von Symposien und Einzelausstellungen, die ihn unter anderem in die USA, nach China und Curaçao führten stets zurück und schuf seine einzigartigen Keramiken: Teekannen und Schalen, Vasen, Krüge. Er sagt: „Oft lasse ich meine Werkstatt so aussehen, also ob ich verreist bin. Ich will ja arbeiten.“ Was zeichnet seine Arbeiten aus? Möhwald macht Kunst, die alltagstauglich und schön für Sonn- und Feiertage ist. Seine Arbeiten sind zugleich auch Gebrauchsobjekte. Das mag auch daran liegen, dass er von 1970 bis 1972 seine Ausbildung zum Scheibentöpfer in den von Hedwig Bollhagen
geleiteten HB-Werkstätten für Keramik in Marwitz absolvierte. Er schöpft allerdings keine Massenware, kein Stück gleicht dem anderen.